Aus dem Schultagebuch von Karl Meißner (Teil 6)
Erinnerungen an die Ostschule

- Eine 4. Klasse der Ostschule Neustadt an der Weinstraße 1958. Archiv: Markus Pacher
- hochgeladen von Wochenblatt Redaktion
Von Markus Pacher
Neustadt. In seinem Schultagebuch erinnert sich mein Großvater Karl Meißner an seine Zeit als Lehrer an der West- und Ostschule zwischen 1949 und 1960. Nach dem Kriegsende unterrichte er zunächst bis zum Sommer 1949 an der Schillerschule in Haßloch, bevor er an seinen Wohnort versetzt wurde und gegen Ende seiner Schulzeit die Hans-Geiger-Schule auf der Hambacher Höhe leitete. In loser Folge möchten wir die Aufzeichnungen von Karl Meißner unseren Leserinnen und Lesern zugänglich machen. Sie bilden ein wichtiges Dokument zum Unterrichtssystem im Nachkriegsdeutschland.
Ein großer Teil der katholischen Lehrerschaft ruft wieder den alten katholischen Lehrerverein in s Leben. Er steht im Schatten der Kirche und kämpft lange Zeit für die Erhaltung der Konfessionsschule. Erst als sich dieser Schultyp später aus politischen Gründen nicht mehr halten lässt, umgibt sich der Verband mit einem neutralen Mäntelchen, indem er seinen Namen ändert.
Kehr wir nach diesem Ausflug in di Gefilde der Berufsvertretungen zurück in die Schulstube. Ich unterrichte zunächst in der Hauptschule dritte und vierte Klassen. Die Jahrgänge liegen mir, zum einen vom Stoff her gesehen (Heimatkunde) und zum anderen von den Kindern. Es sitzen darin noch die begabten Jungen und Mädchen, die nach der Grundschule zur Oberschule abwandern. In einer dritten Klasse erlebe ich wahre Wunder von Schülerleistungen. Die kleinen Burschen von acht oder neuen Jahren schreiben seitenlange Aufsätze über jedes nur erdenkliche Thema, sowie es ihnen schmackhaft gemacht wird. Ihre Fantasie lässt sich mühelos den Postillion auf seiner Fahrt begleiten oder dem Ritter bei der Verteidigung seiner Burg. In farbenprächtigen Bildern schildern sie ihre inneren Erlebnisse. Erfreulich ist ihre kritische Einstellung dem Lehrstoff gegenüber.
Als sich beim Thema Weinlese ein Fass in perspektivischer Manier an die Tafel zeichnen, ruft das Söhnchen des Maler Martin Ritter: „Herr Lehrer, das ist falsch, der Boden vom Fass ist rund. Sie haben ihn oval gezeichnet.“ „Du hast recht, aber so sieht man ihn von der Seite“, entgegne ich. Er will mir nicht glauben. „Na, dann frag doch einmal deinen Vater!“. Am nächsten Tag erklärt er freimütig, dass ich das Fass richtig gezeichnet habe, sein Vater male es genauso.
Oder ich denke an eine Visitation durch den Schulrat Sauerheber. Wir haben im Heimatunterricht von dem Casimirianum gesprochen. Es war einst eine Universität, von den Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten Casimir gegründet. Herr Sauerheber hat darüber ein Diktat aufgesetzt, das er den Jungen satzweise vorliest. Bei dem Wort Heidelberg spricht er das „g“ am Ende des Wortes breit wie ein mundartliches „sch“ aus. Schon meldet sich Frank, einer meiner eifrigsten Schüler. „Sie wollen Schulrat sein“, sagt er patzig. „Sie sprechen ja Heidelbersch, die Stadt heißt aber Heidelberg“. Ja, da sitzt auch ein Schulrat auf dem Leim. Er versucht sich herauszuhaspeln und erklärt, dass die Bühnensprache zum Beispiel das „g“ am Ende eines Wortes nie spreche, sondern ein weiches „ch“. Das „g“ höre man nur, wen ihm noch Selbstlaute folgen. Schon gut, aber das breite „sch“ ist damit nicht entschuldigt.
Autor:Markus Pacher aus Neustadt/Weinstraße |







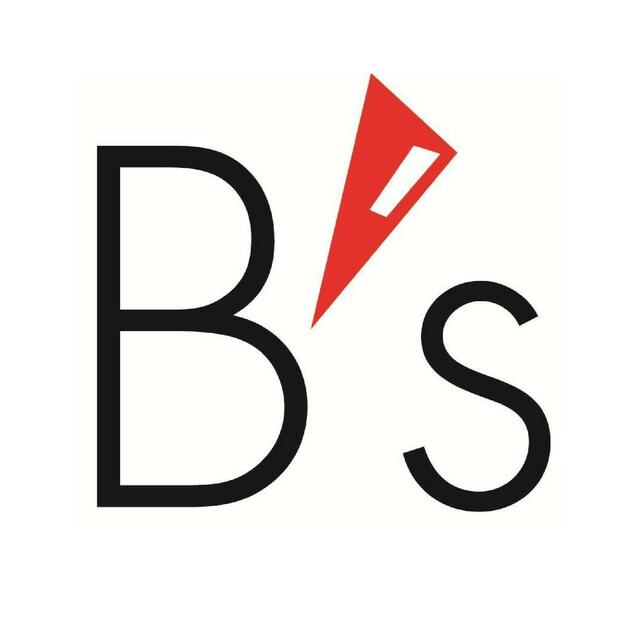



Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.